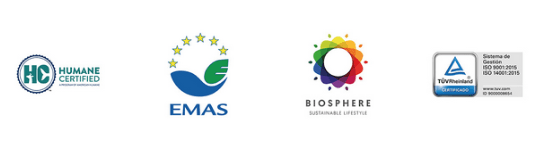Die Aktivisten der Organisation Peta treten laut und aggressiv für Tierrechte ein.
Wie kommt es, dass sie im Verborgenen einen Pakt mit einem Konzern der Fleischindustrie geschlossen haben?
von Anne Kunze und Stefan Willeke
Fragt man die Schauspielerin Jana Wagenhuber, warum sie sich an einem frostigen Wintertag vor einem Pelzgeschäft in der Ham burger Innenstadt auszieht, ihre selbst genähten Stulpen über streift, den Oberkörper mit Ketchup beschmiert und sich halb nackt auf ein Kojotenfell legt, warum sie sich von Passanten begaffen und später auf Facebook als SilikonSchönheit verspotten lässt, warum sie eine halbe Stunde lang vor Kälte bibbert und warum sie lange darüber nachgedacht hat, ob ihre entblößten Brüste die bestmögliche Provokation abgeben könnten, dann bekommt man viele Antworten.
»Weil alles perfekt sein muss.«
»Weil ich es für Peta tue« – Peta, die gemeinnützige Organisation der Tierschützer.
»Weil Tiere ohne jegliches Böse leben.«
»Weil Tiere hilflos sind.«
»Weil es eine Riesenehre war, als mich Peta angesprochen hat. Ein Ritterschlag.«
»Weil Peta immer hinter mir steht und ich mich nicht allein fühle.«
»Weil ich Peta richtig vergöttere.«
Das alles spielte eine Rolle, als Jana Wagenhuber im Januar vergangenen Jahres beschloss, sich auf das eiskalte Pflaster zu legen und gegen die Verwendung von Tierpelzen zu demonstrieren. Man könnte erwähnen, dass Jana Wagenhuber eine ganz besondere Schauspielerin ist, eine, die sich als Schlagersängerin versuchte, in Nachtclubs auf St. Pauli kellnerte und jungen Frauen das Tanzen an der Stange beibrachte. Aber das würde ihr nicht gerecht. Sie ist Veganerin, trägt kein Leder. Sie liebt Tiere. Ihre Mutter suchte Rat beim Kinderarzt, als Jana mit zehn aufhörte, Fleisch zu essen. Ihr Vater schmiss sie raus, als sie mit 18 einen Schäferhundmischling anschleppte, den sie bei sich zu Hause aufnehmen wollte.
Zusammen mit großen Hunden lebte sie in feuchten, heruntergekommenen Häusern in Norddeutschland, eröffnete eine Hundepension auf Mallorca. Sie zog oft um, sie schlug sich durch. Als Jana Wagenhuber von einer Peta-Mitarbeiterin gefragt wurde, ob sie sich öffentlich ausziehen wolle, gab es für die Schauspielerin nur eine Antwort: jederzeit. Peta, sagt sie, »das sind die Größten für mich«.
Peta, das bedeutet: People for the Ethical Treatment of Animals. Menschen, die sich für die ethische Behandlung von Tieren einsetzen. Mit Millionen von Unterstützern ist Peta die größte Tierrechtsorganisation der Welt. Sie wurde 1980 in den USA gegründet, und dort ist sie noch immer am stärksten. In Deutschland aber hat sie mit fast 120 Angestellten, unter ihnen viele junge Frauen, ihre zweitwichtigste Basis. Dazu kommen rund 30.000 ehrenamtliche Aktivisten im deutschsprachigen Raum, unter ihnen Prominente wie der Schauspieler Sky du Mont und der Musiker Udo Lindenberg. Ständig wechseln die Themen der Kampagnen, von Zootieren über Wettangler bis zu Fuchsjägern.
Laut einer Auswertung der Zeitschrift PR Report aus dem Jahr 2019 ist Peta die Nichtregierungsorganisation mit der größten Reichweite in Deutschland – dank der sozialen Medien. Die Bewegung Fridays for Future hat es bloß auf den zweiten Platz dieses Rankings geschafft, ganz oben in der öffentlichen Aufmerksamkeit steht Peta. Das liegt auch daran, dass alles, was Peta macht, extrem ist. Extrem schrill. Extrem öffentlich. Extrem hemmungslos.
Das erste Mal fiel Peta in Deutschland im Jahr 2004 auf, als in einer Kampagne die Fotos abgemagerter KZ-Häftlinge neben den Bildern zerrupfter Hühner in einer Geflügelfarm gezeigt wurden. Die Schlagzeile der Kampagne lautete »Der Holocaust auf Ihrem Teller«. Statt sich für diesen schamlosen Vergleich zu entschuldigen, stürzte sich Peta in einen Rechtsstreit mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Peta-Unterstützer brachen in Tierställe ein, um das Leid von Hähnchen und Schweinen zu filmen. Und die Amerikanerin Ingrid Newkirk, 71, die Chefin und Gründerin der Organisation, verfügte in ihrem Testament, dass ihre Leiche einmal Peta vermacht werden solle. Ihr Fleisch solle gegrillt, ihre Haut zu Leder verarbeitet werden, und ihre Beine sollten einmal als Schirmständer dienen – so, wie es mit Tieren gemacht wird.
»Wir sind nicht gerade basisdemokratisch«, sagt Harald Ullmann aus dem dreiköpfigen PetaVorstand in Stuttgart. Wer ihn kennenlernt, hat das Gefühl, er sei der Boss. Das stimmt allerdings nicht. Zwar führt er den Laden, ist aber lediglich der stellvertretende Vorsitzende. An erster Stelle, auch bei Peta in Deutschland, steht die Amerikanerin Newkirk, die sehr selten in Stuttgart auftaucht. Sie thront jedoch über allem. Eine Mitgliederversammlung ist bei Peta schnell organisiert:
Der Verein hat nämlich nur sieben Mitglieder. In einer solchen Rangordnung ist nichts leichter, als den Willen des Vorstands durchzusetzen. Widerspruch regt sich selten.
Wer mit Führungskräften in der Stuttgarter Zentrale spricht, der hört häufig Kampfbegriffe wie Mafia. Oder kriminelle Vereinigung. Oder Massenmörder. Damit sind oft die Konzerne der Fleischindustrie gemeint. Eines scheint deswegen gar nicht zu Peta zu passen: der Kompromiss, der auf einer Übereinkunft mit der Industrie beruht.
Wie kann es dann aber sein, dass sich die angriffslustigen Tierschützer auf eine Art Stillhalteabkommen mit einem Großunternehmen der Fleischindustrie einließen?
Peta verbreitet die Bilder leidender Tiere, die in Versuchslabors und Ställen gequält werden: gepeinigte Affen, misshandelte Masthühner, zerfetzte Schafe. Und diese Organisation geht einen Deal mit einem Konzern ein, der Jahr für Jahr Millionen Tiere schlachtet?
Wie kaum ein anderer hat ein Mensch die Organisation in Deutschland geprägt: der 64-jährige Edmund Haferbeck. In der Hierarchie steht er unter dem Vorstand, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er viele Fäden zieht. Er nennt sich Leiter der Abteilung Wissenschaft und Recht, doch das ist eine grobe Untertreibung. Haferbeck ist der strategische Kopf hinter vielen Aktionen, so etwas wie der Chef für Agitation und Propaganda. Einer seiner Gegner, ein PR-Berater, nannte ihn mal den »Ajatollah von Peta«. Das ist nicht ganz falsch, weil ein Ajatollah sehr viel Wissen anhäuft. Ein Ajatollah ist angewiesen auf die Bewunderung der Gläubigen – und auf Spendengelder. Er darf Fatwas ausstellen, Rechtsgutachten.
Sich selbst nennt Haferbeck »einen Jäger«.
Edmund Haferbeck hat Erfahrungen als Grenzgänger gesammelt. Als er noch in Göttingen Agrarwissenschaften studierte, Ende der Siebzigerjahre, stand er auf der anderen Seite. In seiner Freizeit züchtete er Chinchillas, flauschige Nagetiere, die er zu Hause im ostwestfälischen Detmold in Gehegen hielt und an Händler verkaufte, die die Tiere töteten, um an ihr edles Fell zu kommen. Jedes Fell brachte Haferbeck Geld. Er wuchs in einem konservativen Elternhaus auf, trat der Landjugend bei, wählte CDU und durchzechte mit Bauern viele Nächte. Er tanzte mit den Frauen der Bauern und mit ihren Töchtern. Er wurde Chefredakteur des Fachblatts Chinchilla Post, zeigte seine Zuchterfolge auf Ausstellungen, wollte Preisrichter werden. »Ich bin von der Gegenseite, physisch wie auch kopfmäßig.« So erzählt er es in einem von drei langen Interviews, die er der ZEIT in Stuttgart gab.
Haferbecks Seitenwechsel vollzog sich in kleinen Schritten, in den Achtzigerjahren. Er fing plötzlich an, sich für Naturschützer zu interessieren, die auf Straßen Flugblätter verteilten, verliebte sich in junge Frauen, die in der Szene aktiv waren. Ob die Liebe zur Natur der Liebe zu diesen Frauen vorausging oder ob es umgekehrt war, das ist bei ihm nicht eindeutig zu klären. In jedem Fall war Leidenschaft im Spiel. Haferbeck engagierte sich bei den Umweltschützern von Robin Wood, wurde Vegetarier, später Veganer. Die Pelzindustrie übernahm zwar Fahrtkosten, die Haferbeck bei der Vorbereitung seiner Doktorarbeit über die Nerz-, Iltis- und Fuchszucht entstanden waren, aber er distanzierte sich von dieser Welt mehr und mehr. Schließlich verkaufte Haferbeck seine Chinchillas. Er fühlte sich »dabei ertappt, dass ich auf einem vollkommen falschen Weg war«. So sagt er das heute. Noch immer tanzte er auf Festen mit den Frauen von Bauern, aber diesmal mit dem Ziel, ihnen Betriebsgeheimnisse zu entlocken.
Er half mit, Dutzende Versuchstiere, Hunde und Katzen, aus einem Forschungsinstitut zu befreien, und wurde danach von Polizisten observiert. Er hatte jetzt Freunde, die darüber nachdachten, solche Labors in die Luft zu jagen. Aber das sei ihm, sagt Haferbeck, zu weit gegangen. Er schrieb Bücher, dick wie Backsteine, wüste Rundumschläge gegen die Justiz, die Tierversuche ermögliche. Auf dem Cover eines Buches nannte er Deutschlands Behörden eine »kriminelle Vereinigung« – allerdings mit einem Fragezeichen.
In Schwerin wurde er Umweltdezernent der Grünen und legte sich massiv mit einer Industrie an, die er noch heute »Abfallmafia« nennt. Als Spezialist für grobe Schlachten machte er sich einen Namen. Einmal verwickelte er sich in ein Handgemenge, als er die Tür eines Autos aufriss, in dem ein Manager der Müllindustrie saß. Haferbeck griff nach Aktenordnern auf dem Beifahrersitz und rannte damit weg. Ein anderes Mal besuchte ihn zu Hause ein Boxer, der wahrscheinlich angeheuert worden war, und schlug mit der Faust in Haferbecks Gesicht.
Die Freundin, mit der Haferbeck damals zusammen war, ist heute seine Ehefrau. Sie erlebte, wie ihn ein Schlaganfall erwischte, nachdem er Woche für Woche 80 Stunden gearbeitet, nachts kaum noch geschlafen und sich gewaltig über die Mafia aufgeregt hatte. Sie sagt: »Was ihn antreibt, das ist auch seine Wut. Er rennt sofort los, wenn ihn was stört.«
Nachdem Haferbeck im Jahr 2004 bei Peta eingestiegen war, führte er juristische Kämpfe gegen alles, was sich Peta in den Weg stellte. Damals bestand der Laden nur aus fünf Leuten, ein Club der Exoten. Veganer? Nicht einmal das Wort war den meisten Deutschen geläufig. Manche Menschen hielten Peta für so etwas Obskures wie die Scientology-Sekte. Aber die Organisation wuchs und wuchs. Inzwischen sind die Peta-Leute im Raum Stuttgart dreimal umgezogen, weil immer mehr Angestellte hinzugekommen sind.
Edmund Haferbeck baute eine investigative Truppe auf, die in Tierställe einbrach, reichte Strafanzeigen ein, um gegen Jäger, Tierzüchter und Groß-metzger vorzugehen. So gut wie jede Staatsanwaltschaft in Deutschland hat es schon mit Edmund Haferbeck und seinen peniblen rechtlichen Ausführungen zu tun bekommen. Haferbeck beobachtet Gerichtsprozesse, die auf seine Anzeigen zurückgehen, bezeichnet gegnerische Juristen gern als »MafiaAnwälte«. Einen Rechtsanwalt, der mehrere Firmen der Fleischindustrie vertreten hat, nennt er »ein richtig charakterloses Arschloch«. Und fügt hinzu: »Das können Sie so zitieren.«
Ruft man Haferbeck im Urlaub an, fühlt er sich nicht gestört. Er antwortet dann: »Kommen Sie vorbei, jetzt habe ich endlos Zeit.« Schickt man ihm an einem Sonntag um 22 Uhr eine E-Mail, kann es passieren, dass er zwei Minuten später antwortet. Einmal schloss er sich während einer Zugfahrt auf der Toilette ein, um diskret mit einem Fernsehsender zu telefonieren.
Der Hamburger Rechtsanwalt Walter Scheuerl, der oft im Auftrag der Fleischindustrie vor Gericht aufgetreten ist, sagt über Peta: »Von der Professionalität her sind die allemal erste Liga. Die haben eine unerschöpfliche Portokasse, um rechtliche Konflikte durchzustehen.« Er hält Peta für »einen großen Player auf dem Spendenmarkt«. Rund elf Millionen Euro Spenden nimmt der Verein im Jahr ein, ein großer Teil des Geldes stammt aus Erbschaften. »Wir sind satt«, so drückt es der PetaFunktionär Haferbeck aus. Überraschend bekam der niedersächsische FDPPolitiker Gero Hocker im August 2017 einen Einschreibebrief von Peta, eine Unterlassungserklärung.
Der Bundestagsabgeordnete wunderte sich. Er hatte auf einer Veranstaltung über Umweltpolitik gesprochen und dabei Methoden von Peta kritisiert, zum Beispiel Stalleinbrüche. Der Politiker unterzeichnete die Erklärung nicht, er sagt: »Ich lasse mir doch keinen Maulkorb verpassen. Peta hat ein schlaues Geschäftsmodell. Es beruht auf Einschüchterung.« Nun schrieb der Politiker einen Antwortbrief an den Peta-Vorstand in Stuttgart. Es war eine Einladung. Man könne doch auf einem Podium über die Streitpunkte debattieren.
Peta lehnte ab. An öffentlichen Diskussionen nehmen die Tierrechtler selten teil. Viel lieber sind ihnen gezielte Angriffe auf uneinsichtige Gegner. Petas wichtigster Widersacher war stets die Fleischindustrie, im Jahr 2009 steuerten die Konflikte auf einen Höhepunkt zu. Die Firma Wiesenhof, Deutschlands größter Geflügelschlachter, wurde zum Zielobjekt der Tierrechtler. Auf Veranstaltungen zeigte Edmund Haferbeck Videos aus WiesenhofStällen, schockierende Aufnahmen halb toter Puten, die brutal durch die Gegend geschleudert wurden. Für Peta gab es nur ein Ziel: »Wiesenhof sturmreif schießen, ganz klare Sache, sturmreif schießen.« So formuliert es Haferbeck heute. Im Fernsehen liefen plötzlich Beiträge über die grauenvollen Zustände bei Wiesenhof, die Aufnahmen stammten oft von Peta-Unterstützern.
Bilder von Zehntausenden Hühnern wurden gezeigt, dicht an dicht, die in riesigen Hallen auf ihren Tod warteten. Hühner, die so schnell so viel Fleisch ansetzten, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten, jämmerlich verdursteten und verhungerten. Hühner, die einander tottrampelten. Es ging darum, hieß es auf der Peta-Internetseite, »die hässliche Fratze der Gewalt gegen die Hühner in der industriellen Massentierhaltung von Wiesenhof zu dokumentieren«. Für Haferbeck waren die Aktionen gegen Wiesenhof eine »Signalkampagne«, seine Gegner würden es wahrscheinlich Treibjagd nennen. Aber mit einem Mal passierte etwas Seltsames.
Im Frühjahr 2012 rief bei Haferbeck ein Mensch an, dessen Name ihm fremd war. »Wenn ich sage, wer ich bin, legen Sie gleich auf«, habe der Anrufer gesagt. Haferbeck legte nicht auf, sondern hörte sich an, was der Chefeinkäufer der Firma Wiesenhof von ihm wollte. Der suchte im Auftrag der Firmenchefs Kontakt mit Verantwortlichen von Peta. Später erfuhr Haferbeck, dass Peta dem Konzern schwer geschadet hatte. Rund 100 Millionen Euro sollen ihm entgangen sein, weil einige Discounter und Lebensmittelketten keine Wiesenhof-Produkte mehr haben wollten. Es seien erheblich weniger als 100 Millionen Euro Einbuße gewesen, erklärt die Firma Wiesenhof. Fest steht, dass die PetaKampagnen das Unternehmen viel Reputation und Geld kosteten. Versuchte der Chefeinkäufer, nun Haferbeck einzukaufen?
In höflichen Worten schlug der Mann am Telefon ein persönliches Treffen vor, und Haferbeck willigte ein. Wie wäre es an einem neutralen Ort, der Lounge im Frankfurter Hauptbahnhof?
Was die beiden dort im August 2012 verabredeten, ist nur zu erahnen. Das Treffen wurde von Haferbeck als »vertraulich« und »konspirativ« eingestuft, allein den Peta-Vizechef Harald Ullmann hatte er darüber unterrichtet. Aus Sicht des Wiesenhof-Managers muss es ein großer Erfolg gewesen sein. Denn wenige Wochen später reisten Ullmann und sein Frontkämpfer Haferbeck zur Firma Wiesenhof nach Niedersachsen, um sich den Eigentümern des Konzerns vorzustellen, die mit Hähnchen, Enten und Puten sehr reich geworden sind. Die Besucher aus Stuttgart plauderten mit dem Seniorchef Paul-Heinz Wesjohann und dem Junior Peter Wesjohann, der die Geschäftsführung vom Vater übernommen hatte. »Es war ein konstruktives Gespräch«, sagt Wesjohann, der jüngere, heute.
Die vier Männer verabredeten gleich einen Gegenbesuch bei Peta in der Nähe von Stuttgart. Haferbeck war begeistert von seinen neuen Bekannten. Er sah in ihnen jetzt sympathische Menschen. Als »handschlagfest« bezeichnet er sie heute, als ehrbare Kaufleute, »fast akademisch, dabei ohne Prunk«, als »bodenständig und bescheiden« und nicht so verschlagen wie viele der Groß-bauern, die er in seinem Leben kennengelernt hatte. »Die wollen einen nicht verarschen«, sagt Haferbeck. Er beschreibt die Annäherung an Wiesenhof so: »Wir haben nun eine gewisse Ebene.«
Mit einem Mal kam sich Haferbeck ungewohnt mächtig vor. Er hatte zwar die Medien oft mit Bildern beliefert und dadurch Aufmerksamkeit geschaffen, er hatte Strafanzeigen gestellt und damit Staatsanwälte hellhörig werden lassen. Aber er fühlte sich dennoch oft machtlos, weil Peta zwar Menschen aufrütteln kann, aber keine politische Gewalt besitzt. Und plötzlich suchten die Chefs eines Konzerns Haferbecks Nähe? Das war noch nie vorgekommen. Vielleicht konnte er seinem Ideal von der veganen Gesellschaft auf diese Weise den Weg bereiten.
Die Wut, die ihn stets erfüllt hatte, muss sich plötzlich in etwas anderes verwandelt haben, in Verhandlungsgeschick, strategische Cleverness, zwei Eigenschaften, die auch Manager in der Industrie benötigen. Haferbeck sagt: »Anfangs dachten die Wesjohanns von uns, wir seien die größten Kriminellen.« Das änderte sich dann.
»Bevor die Gespräche begannen, hatte ich Peta als aggressiv empfunden«, sagt der Firmenchef Wesjohann heute. Aber er dachte um.
Als die Wiesenhof-Chefs im Oktober 2012 aufdem Stuttgarter Flughafen landeten, wartete Edmund Haferbeck auf sie schon in einer BMW-Limousine. Er hatte sich den imposanten Wagen eigens geliehen, um einen »standesgemäßen Eindruck« zu erwecken.
Eine hübsche, junge Anwältin, die damals für Peta arbeitete, wurde von Haferbeck im Fond des Wagens platziert, damit die Gesprächsatmosphäre sofort etwas lockerer würde. »Kommt dahinten bloß nicht auf dumme Gedanken«, so eine Art von Scherz habe er gemacht, sagt Haferbeck.
Sie fuhren zur Peta-Zentrale, einem unscheinbaren Bürohaus. Monate zuvor hatten die Besucher aus Niedersachsen einen schockierenden Report im Fernsehen verfolgen müssen, der die Grausamkeiten in Tierställen anprangerte, die Wiesenhof belieferten. Einige dieser Bilder hatte Peta beschafft. »Die waren verzweifelt. Die wussten nicht mehr, was sie machen sollten«, sagt Haferbeck heute. Die Gäste erklärten, dass sie die Produktion in ihrem Konzern verändern wollten. Ein bisschen weniger Massentierhaltung, ein bisschen mehr Tierschutz, außerdem werde man sich um eine vegane Produktlinie bemühen. Peter Wesjohann sagt heute, Peta sei »auch ein wesentlicher Teil des Anstoßes« bei dieser Entwicklung gewesen.
D as böse Unternehmen Wiesenhof werde sich bessern, das war die Botschaft. Sie verfing so sehr, dass Edmund Haferbeck seinen Gästen sogar glaubte, sie seien über die Verhältnisse in den Hühnerställen nicht ausreichend informiert gewesen. Fragt man ihn heute danach, windet er sich. Herr Haferbeck, Sie gestehen den WiesenhofChefs zu, nicht gewusst zu haben, was in den Ställen vorgeht. Sie glauben ihnen das?
»Ich will es glauben.« Der Hühnerbaron weiß nicht, wie die Hühner leben?
»Ja, er weiß nicht im Detail, wie die Hühner leben.«
Die neue Sanftmut könnte damit zusammenhängen, dass der Besuch der Wesjohanns so erfreulich endete. Die Gäste wurden in eine Pizzeria eingeladen, vegane Nudelgerichte wurden serviert. Neben Haferbeck und dem Peta-Vizechef war auch dessen Frau Andrea Müller dabei, die den Vorstand der Tierrechtler berät. »Angenehme Gesprächspartner«, sagt der Vizechef über die Wesjohanns, »höflich und respektvoll.«
Haferbeck chauffierte die Besucher in seiner Limousine zurück zum Flughafen, und auf einem Tisch im Peta-Büro lag zu dieser Zeit etwas Erstaunliches, ein Briefumschlag. Hochinteressante Unterlagen steckten darin: die Adressen von 49 Hühnerställen, in denen Tiere für das Unternehmen Heidemark gemästet wurden, einen der ärgsten Konkurrenten von Wiesenhof. Nach diesen Informationen hatte Peta lange vergeblich gesucht. Nun war es endlich möglich, die Ställe von Heidemark systematisch unter die Lupe zu nehmen.
Wiesenhof teilt dazu mit, weder der Junior- noch der Seniorchef habe »eine solche Liste an Peta weitergegeben«. Die beiden wüssten nicht einmal, wo sich die Ställe der Firma Heidemark befänden.
Die Ställe der Fleischkonzerne sind ein streng gehütetes Geheimnis. Sie liegen unbeachtet in der Landschaft, aschgraue flache Gebäude, kein Schild verrät den Besitzer. Wen diese Mäster beliefern, ist oft nur Insidern bekannt. Deswegen war der Inhalt des Briefumschlags eine Offenbarung: all diese Ställe mit Adressen, die Stützpfeiler des Heidemark-Reichs.
Heidemark war verwundbar geworden. Was sich anschließend abspielte, kam für den Grenzgänger Haferbeck einem Triumphzug gleich. Nach und nach besuchten Tierschützer einige der Ställe, vor allem in Baden-Württemberg. Sie brachten Fotos und Filme mit. Peta versuchte nun, Heidemark in die Enge zu treiben, und erschuf den »Heidemark-Skandal«. In Videos, die von der Organisation verbreitet wurden, galt Heidemark als neuer Bösewicht, als »Marktführer für organisierte Tierquälerei«. Die Videos zeigten leidende Tiere aus dem »Heidemark-Imperium«. Man sah, wie Puten in die Laderäume von Lastwagen getreten, gestoßen und geschubst wurden. Dort blieben sie stundenlang, bevor man sie bei vollem Bewusstsein ans Schlachtband hängte. Im Video sprach eine Frauenstimme von einer »Tortur«.
Wiesenhof, der Feind von gestern, war Heimlich zum Freund mutiert, während Heidemark in die Schusslinie geriet. In der Geschichte der Tierrechtler war es eine Zäsur. Der Pakt mit Wiesenhof, von dem kaum jemand etwas ahnte, entfaltete seine Wirkung.
Aus einer gemeinnützigen Organisation wurde eine Truppe von Dealern, die sich mit der Industrie verständigt. Das Wort »Deal« lehnt Edmund Haferbeck ab, er sucht lange nach einem Begriff.
Ein Stillhalteabkommen mit Wiesenhof? Nein. Ein Gentlemen’s Agreement? Nein. Eine Übereinkunft? Nein. »Zwei Gegner, die sich per Handschlag auf bestimmte Dinge geeinigt haben«, so sieht er das.
Er nennt es »einen Dialog«. In Wahrheit besteht dieser Dialog aus einem vertraglosen Frieden. Schriftlich fixiert ist nichts, auf kein Papier könnte man Peta und Wiesenhof festnageln. Aber beide Seiten leben offenbar hochzufrieden mit dem Deal.
»Wir haben bei Wiesenhof nichts mehr gemacht«, gibt Haferbeck zu. Später schreibt er in einer E-Mail von der »bundesweit schon besonderen Art und Weise des Miteinander-Umgehens«.
Der Konzernchef Peter Wesjohann sagt: »Es wurde ruhiger um uns.« Und fügt hinzu: »Die anderen Unternehmen haben gemerkt, dass wir mit Peta gesprochen haben.«
Man kann die Krieger dieser Organisation auf andere Gegner hetzen, die Wut umlenken. Wiesenhof hat den Tierrechtlern kein Geld gezahlt, sich aber Ruhe verschafft, Ungestörtheit, Unbedenklichkeit, sogar Wohlwollen. Und das, obwohl die vegane Produktlinie bei Wiesenhof drei Jahre auf sich warten ließ und noch heute gerade mal zwei Prozent des Umsatzes im Geschäftsbereich Würste ausmacht.
Weiterhin besucht Haferbeck die Wesjohanns regelmäßig und schickt Wiesenhof-Managern Grüße zu Weihnachten. Über Interna des Unternehmens wird er immer wieder informiert. Spielt der Fußballverein Werder Bremen, der von Wiesenhof gesponsert wird, tauscht Haferbeck mit einem Manager des Konzerns manchmal SMSNachrichten aus. Für ein Online-Spiel mit kackenden Hühnern, das sich die Peta-Jugend ausgedacht hatte, um damit die Wesjohanns zu verspotten, entschuldigte sich Haferbeck persönlich beim Seniorchef. Hin und wieder gönnen sich Peta und Wiesenhof weiterhin juristische Scharmützel, aber wenn man weiß, wie unversöhnlich die Schlacht einmal war, dann erkennt man die Dimension dieses modernen Ablasshandels.
Aus dem Dealen ist ein Geschäftsmodell geworden. Mit rund 1200 Unternehmen ist Peta inzwischen »im Dialog«, von Mercedes-Benz über Esprit bis Hugo Boss. Wer auf seine veganen Produkte aufmerksam machen will, kann ein Logo namens »PetaApproved Vegan« kaufen. Die Höhe der Lizenzgebühr hängt vom Umsatz ab. Damit sich eine Firma mit dem Peta-Label schmücken darf, reicht ein einziges veganes Produkt aus. Beim Textilhersteller Hugo Boss ist der vegane Anzug nicht mehr als ein Nischenprodukt. Außerdem verzichtet das Unternehmen darauf, echten Pelz zu verarbeiten – was es auch zuvor kaum tat, wie eine Sprecherin der Firma sagt.
Zu den gefragtesten Führungskräften bei Peta gehört inzwischen der Marketingchef. Die Unternehmen sprechen gern über ihre Annäherung an Peta. Edmund Haferbeck sagt voller Stolz: »Die Firmen kommen mittlerweile mit Ideen auf uns zu.« Industriekonzerne suchen die Nähe Petas, weil sie die Kampagnen fürchten. Die Kampagne ist das schärfste Schwert. So sieht es auch die 30-jährige Charlotte Fischer, die bei Peta alle Waffengattungen kennt. Im Verein leitet sie die Abteilung Social Media, das entscheidende Schlachtfeld. Während eines Spaziergangs durch Berlin-Neukölln, den sie oft mit ihrem Hund macht, sagt sie: »Wir identifizieren zunächst eine Industrie. Dann schauen wir, ob es sich lohnt, ein Unternehmen in den Fokus zu rücken. Das ist meistens der Fall, wenn es bekannt ist.« Bei weniger prominenten Unternehmen seien Angriffe schwieriger zu planen. »Da muss man erst mal darauf aufmerksam machen, wo überhaupt das Problem liegt. Zum Beispiel Wolle. Wolle ist für unsere Follower der neue Pelz. Da machen wir erst mal eine Woche lang Postings zu Angora«, sagt Charlotte Fischer. Dann spricht sie beim Spaziergang lange von Angorakaninchen, denen das Fell ausgerissen wurde. Peta zeichnete die Schmerzensschreie auf und beschallte damit Fußgängerzonen. Es klang grauenvoll.
Die Radikalität in Ton, Wort und Bild ist geblieben, aber Peta ist auf einen Kuschelkurs umgeschwenkt, um Unternehmen für sich zu gewinnen. »Erst mal schreiben wir Briefe«, sagt Charlotte Fischer.
Briefe?
»Ja, Briefe, oft mehrere hintereinander. Darin fordern wir das Unternehmen auf, etwas zu ver- ändern.«
Und falls das nicht wirkt, folgt der Angriff?
»Nur, wenn das Unternehmen keine Gesprächsbereitschaft signalisiert.«
Es genügt, wenn das Unternehmen ein Gespräch in Aussicht stellt – schon lässt Peta von ihm ab.
»Gerade in der Modebranche dauern die Prozesse oft Jahre. Da muss man viel Geduld haben.«
Welches Unternehmen derzeit am heftigsten von Peta attackiert wird?
»TUI«, sagt die Aktivistin.
Der Reiseanbieter? »Ja. TUI bietet immer noch Reisen zu Aquarien von Seaworld an, wo Orcas gehalten werden.«
Es gibt drei Seaworld-Aquarien mit 20 Orcas, alle in den USA, und alle haben angekündigt, keine neuen Orcas mehr zu züchten.
Hat Peta das Ziel aus den Augen verloren? In Deutschland werden Tag für Tag mehr als zwei Millionen Tiere geschlachtet. Aber Peta interessiert sich für 20 Orcas in Amerika. Peta kümmerte sich auch rührend um das Wohl eines Esels, der bei den Oberammergauer Passionsspielen den Jesus-Darsteller herumschleppte. Ob man das Tier nicht durch einen E-Scooter ersetzen könne?
Peta ist keineswegs die einzige Nichtregierungsorganisation, die mit der Industrie zusammenarbeitet. Der World Wide Fund for Nature pflegt »Kooperationen« mit Unternehmen – und bekommt dafür stattliche Honorare. So zahlt der Outdoor-Konzern Vaude der Organisation für die »Kommunikation zur Sensibilisierung von Nachhaltigkeitsthemen« bis zu 250.000 Euro im Jahr. Greenpeace sucht das Gespräch mit Unternehmen und fährt Kampagnen gegen diejenigen, die aus der Sicht der Umweltschützer zu wenig tun. Beim Naturschutzbund Deutschland können Firmen eine Lizenz für das Nabu-Logo kaufen. Die kostet die Firmen mindestens 15.000 Euro im Jahr.
Innerhalb der eigenen Szene wird Peta scharf kritisiert. Friedrich Mülln, der die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz gründete, nennt Abkommen wie die mit Wiesenhof einen »Pakt mit dem Teufel«. Er sagt: »Man muss aufpassen, dass man bei der Umarmung nicht die Luft verliert.« Die Peta-Chefin, die Amerikanerin Ingrid Newkirk, ist jedoch begeistert von all den Deals, die sich die deutsche Sektion hat einfallen lassen. Am Telefon sagt Newkirk: »Den veganen Anzug von Hugo Boss hat sogar Joaquin Phoenix schon getragen!«
Die »Erziehung der Einzelhändler« sei wichtig, um den Weg in eine vegane Zukunft zu bahnen. Ist das Dealen das neue Rebellieren?
Es gab Unterstützer, die sich von Peta wegen des schleichenden Kurswechsels abwandten, etwa der Musiker Bela B von der Punkband »Die Ärzte«. Auch einige Angestellte murrten, aber der interne Aufstand blieb aus. Das liegt vor allem an den autoritären Strukturen des Vereins. In den USA, im Hauptquartier der obersten Peta-Chefin, hatte sich das Dealen mit Unternehmen schon länger etabliert. Und was die Amerikanerin will, geschieht auch in Deutschland. »Es gibt bei uns garantiert Mitarbeiter, die unseren Kurs nicht gut finden«, sagt Edmund Haferbeck, »aber an unserer Linie ändert sich nichts. Das wird so gemacht. Mit weniger Fundamentalismus können wir mehr erreichen. Fundamentalismus ist eine Sackgasse.«
Stimmt das? Verbessern die Dealer die Verhältnisse stärker als die Radikalen, die ihre Gegner unermüdlich bekämpfen?
Wenn die Veränderung der Natur so fundamental ist, dass die Antworten darauf radikaler ausfallen müssen denn je, dann war Peta der Zeit oft weit voraus. Peta war schon radikal, lange bevor sich der Gedanke von der Radikalität politischen Handelns verbreitete. Menschen machen sich die Erde untertan, und zu den Leidtragenden zählen Tiere – Lebewesen, die den Menschen am nächsten stehen. Menschen vergreifen sich an ihren Nächsten, so weit ist es gekommen. Rettet man die Tiere vor den Menschen, dann rettet man vielleicht auch die Erde, am Ende vielleicht sogar die Menschen selbst. Verramscht Peta dieses Ideal mit all den Deals, oder ist es umgekehrt: Nähert sich Peta dadurch seinen Zielen an? Man kommt der Antwort näher, wenn man sich fragt: Wie geht es den Hähnchen bei Wiesenhof heute?
Peter Wesjohann, der Firmenchef, berichtet stolz, sein Unternehmen habe sechs sogenannte Tierschutzkonzepte entwickelt. Aber zur Wahrheit gehört, dass es den allermeisten Masthühnern fast genauso schlecht geht wie früher. Das Konzept, das für den Großteil der Hähnchen gilt, heißt Initiative Tierwohl und ist kaum besser als die gesetzlichen Vorgaben, die einem Hähnchen einen Lebensraum zugestehen, der kleiner ist als die Fläche eines DIN-A4-Blatts.
Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz nennt diese Initiative »ein riesiges Tarnmanöver«. Er sagt:
»Es laufen vielleicht zwei, drei Hähnchen weniger auf dem Quadratmeter herum, trotzdem bleibt der Boden bedeckt von Tieren.« Das beweisen auch aktuelle Fotos von Wiesenhof-Ställen, aufgenommen von der Soko Tierschutz. Vergleicht man diese Bilder mit denen, die 20 Jahre alt sind, dann erkennt man, dass sich nichts Wesentliches verändert hat. Noch immer stehen da diese riesigen Hallen voller Hühner. Die Tiere sind so gezüchtet, dass sie innerhalb weniger Wochen das Vierzigfache ihres Gewichts zunehmen, so schnell, dass ihr Skelett den Körper kaum noch tragen kann.
Viele Tiere können nur noch liegen, die schwächeren verenden an Hunger und Durst. Ihre Füße sind entzündet. Sie haben keine Stangen, auf denen sie nachts sitzen können, nicht einmal einen Strohballen, in dem sie herumpicken können.
Wiesenhof erwirtschaftet heute rund 230 Millionen Euro Umsatz mehr als 2012, im Jahr des Friedensschlusses mit Peta. Mittlerweile schlachtet der Konzern rund vier Millionen Tiere – pro Woche.
»Wiesenhof hat diese Gegend ausgelutscht.« So sagt es Lutz Neubauer, ein ehemaliger Chefarzt aus Lohne in Niedersachsen. Er wohnt in der Nähe eines gigantischen Wiesenhof-Werks und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Konzern.
W iesenhof darf hier bis zu 430.000 Tiere am Tag schlachten. Auf Nachfrage erklärt der Konzern allerdings, derzeit nur bis zu 250.000 Tiere zu schlachten.
Für jedes Tier, das abgespritzt und ausgespült werden muss, sagt Neubauer, brauche man inclusive Reinigung acht Liter Wasser. Schon vor Jahren fiel ihm auf, dass viele private Brunnen in der Umgebung austrockneten. Er begann, den Stand des Grundwassers zu kontrollieren, verglich ihn mit den offiziellen Messdaten und stellte fest: Der Grundwasserspiegel sinkt langsam, aber stetig.
Wiesenhof darf hier 800.000 Kubikmeter Grundwasser im Jahr fördern, eine unglaubliche Menge, so viel, wie eine Kleinstadt im Jahr verbraucht. Gegenüber der ZEIT gibt der Konzern an, die von den Behörden genehmigte Menge werde »nicht ausgeschöpft«. Der Schlachthof habe keinen Einfluss auf den Grundwasserspiegel in der Umgebung. Dies sei auch durch Gutachten belegt.
Neubauer hingegen fällt auf, wie sehr die Vegetation leidet. Die Wurzeln der alten Bäume finden kein Wasser mehr. Wozu das führt, kann man sehen, wenn man mit ihm durch die Gegend rund um den Schlachthof fährt. Viele Bäume sind klein geblieben, sie wachsen nicht mehr. Auch das Moor ist inzwischen zu trocken. Neubauer steigt aus dem Auto und stapft einen Abhang hoch. Er zeigt auf einen kleinen Tümpel, ein fast zugewachsenes Biotop. Man muss schon genau hinsehen, um noch den mickrigen Rest einer Wasserstelle zu erkennen.
Als die Produktion bei Wiesenhof vor fünf Jahren wegen eines Zwischenfalls stark gedrosselt werden musste, erholte sich die Natur ein wenig.
Der Grundwasserspiegel sei gestiegen, erzählt Neubauer, die Frösche seien zurückgekehrt. Ein Moor, ein Tümpel, ein paar Frösche – Belanglosigkeiten, über die man hinwegsehen kann? Wer dieser Meinung ist, der könnte sich in Königs Wusterhausen umsehen, einer Stadt nahe Berlin. Auch hier hat Wiesenhof einen Schlachthof. An den Gestank, sagt die Anwohnerin Gudrun Eichler, hätte sie sich vielleicht noch gewöhnt.
Auch ihre Freundinnen hätten sich damit abgefunden, dass Gudrun Eichler sie nur unter Vorbehalt zum Kaffeetrinken in den Garten einlädt, dann, »wenn es gerade nicht stinkt«. Aber als sie vor fünf Jahren erfuhr, dass Wiesenhof den Schlachthof vergrößern wollte, reichte es ihr.
Zusammen mit anderen gründete sie eine Bürgerinitiative, »KW stinkt’s«. Gemeinsam wälzen sie Bauvorschriften, lesen Schlachtprotokolle und sind zu Fachleuten für Wasserrecht geworden.
»Ich habe 2017 selbst erlebt, wie vom Gelände des Schlachthofs fauliges Wasser in den Brandenburger Wald geflossen ist«, sagt Benjamin Raschke, der Fraktionschef der Grünen in Brandenburg.
Dazu erklärt Wiesenhof, heruntergefallenes Laub habe den fauligen Geruch verursacht. Die zuständige Behörde habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass Produktionswasser in den Wald geleitet worden sei.
Außerdem stellte sich heraus, dass Wiesenhof in Königs Wusterhausen bis 2017, mindestens zweieinhalb Jahre lang, viel mehr Geflügel schlachtete als erlaubt. Das Unternehmen hatte die Anlage erweitert. Als Wiesenhof bei der Behörde den Antrag stellte, die Kapazität zu erhöhen, um täglich 160.000 Tiere verarbeiten zu dürfen, schlachtete das Unternehmen bereits so viel. Erlaubt waren 120.000 Tiere am Tag. Auf Nachfrage erklärt Wiesenhof, man habe »sämtliche Voraussetzungen für die Genehmigung der Schlachtmengenerhöhung erfüllt«. Der Grünen-Politiker sagt:
»Wiesenhof bedient sich auf Kosten der Region.
Der Konzern erlaubt sich Dinge, mit denen ein privater Häuslebauer nicht durchkommen würde.«
Das Unternehmen geriet unter Druck, nachdem es in zwei Wiesenhof-Schlachthöfen gebrannt hatte, 2015 in der bayerischen Stadt Bogen und 2016 im niedersächsischen Lohne. Nun musste die Firma auf andere Schlachthöfe ausweichen, auch auf das Werk in Königs Wusterhausen. »Im Gewerbegebiet reihte sich ein Tiertransporter an den nächsten. Manche waren offen, und ich konnte sehen, dass viele Hühnchen in einem sehr schlechten Zustand waren. Einige waren sogar schon tot.
Das haben wir uns nicht gefallen lassen«, sagt Gudrun Eichler von der Bürgerinitiative. Über der Bahnhofstraße hing ein Banner mit der Aufschrift:
»Wiesenhof bescheißt, die Regierung schaut zu.« Der Streit zwischen Wiesenhof und der Bürgerinitiative schaukelte sich hoch, bis Behörden die Firma zwangen, weniger zu schlachten. Wiesenhof gibt an, nicht einmal ein halbes Prozent der Tiere sei während des Transports gestorben. Außerdem hätten sich Lastwagen nicht im Gewerbegebiet gereiht, sondern seien auf dem Gelände des Schlachthofs geparkt worden.
Auffällig ist das enorme Tempo, in dem das Schlachtband bei Wiesenhof läuft. Ein ehemaliger Angestellter des zuständigen Veterinäramtes sagt, es sei unmöglich gewesen, die Qualität des Fleisches zu kontrollieren. »Wir mussten pro Sekunde drei Hähnchen begutachten.« Gesetzlich vorgeschrieben ist etwa die siebenfache Zeit. Der ehemalige Mitarbeiter des Veterinäramtes sagt: »Um die Hähnchen am Band zu sehen, muss man die Augen sehr schnell hin und her bewegen. Das ist fast wie Hypnose. Deswegen schlafen viele auch ein.« Dazu erklärt Wiesenhof, »die gesetzlich vorgeschriebenen Beschauzeiten« würden eingehalten.
Spricht man Edmund Haferbeck auf die Zustände bei Wiesenhof an, antwortet er: »AgrarMafia, Massenmord, natürlich, nach wie vor, klar.«
Aber Peta bekommt davon wenig mit. Haferbeck genügt es, dass sich »das Unternehmen bewegt« und heute eine vegane Produktlinie hat.
So könnte man noch lange weitermachen, von kleinen Skandalen berichten und von großen, man könnte den Wiesenhof-Chef noch einmal zu Wort kommen lassen, der beteuert: »Wir haben uns in Richtung Tierwohl entwickelt.« Aber was hat das alles zu bedeuten? Spannt man einen weiten Bogen, vom MafiaJäger Haferbeck über die geschundenen Hähnchen, über das bedrohte Moor in Niedersachsen und den Gestank in Brandenburg bis zu den hypnotisierten Angestellten eines Veterinäramtes, von der Kampagnen-Radikalität des Vereins Peta bis zur geopferten Radikalität in der Wirklichkeit, dann liegt ein Schluss sehr nahe: Peta, das Bündnis für höhere Gerechtigkeit und strafenden Zorn, hat sich dem Gegner angedient und ihm dadurch ungeahnte Freiräume eröffnet. Nie war Wiesenhof so mächtig wie heute, so ungehindert mächtig. Die gewachsene Macht des Unternehmens korrespondiert mit der taktisch dosierten Macht der Tierrechtler, die gelernt haben wegzuschauen. Einst wollte Peta das System verändern. Jetzt verändert das System Peta. Und das System bleibt, wie es ist.